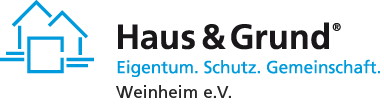


» Zum Onlineantrag
Hinweise zum Erbrecht
Haus & Grund Weinheim informiert

Unter dieser Rubrik finden Sie einzelne Hinweise zum Erbrecht, die nach und nach ergänzt werden. Die Hinweise sollen Ihnen den Einstieg in die Thematik erleichtern, in dem einzelne Begrifflichkeiten vorgestellt und erörtert werden, so dass Sie schon vorab über Grundstrukturen informiert sind.
Alle weiteren Detailfragen können in unserer neuen Erbrechtssprechstunde erörtert werden:
- einmal im Monat
- Mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
Lebzeitige Übertragung von Grundbesitz ("Überlassung")
Wir starten mit der lebzeitigen Übertragung von Grundbesitz und stellen einzelne dort angesprochenen Themen nach und nach vor.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einige Grundbegriffe
- II. Motive und Fallgruppen
- 1. Grundstücksübertragung zur Vorwegnahme der Erbfolge
- 2. Ehebedingte Zuwendung
- 3. Veräußerer mit wirtschaftlich risikobehafteter Tätigkeit
- 4. Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen
- 5. Versorgungsvertrag
- III. Objekte der Überlassung
- IV. Gegenleistungen und Vorbehalte
- 1. Nießbrauch
- 2. Wohnugsrecht
- 3. Wiederkehrende Geldzahlungen
- 4. Naturalleistungen
- 5. Mehrere Berechtigte
- V. Rückforderungsvorbehalt und Verfügungssperren
- 1. Gesetzliche Rückforderungstatbestände
- 2. Vertragliche Rückforderungstatbestände
- 3. Detailausgestaltung
- VI. Weichende Geschwister, pflichtteilsrechtliche Fragen
- 1. Das Pflichtteilsrecht des Erwerbers
- 2. Gesetzliche Ausgleichsansprüche
- 3. Vertragliche Ausgleichsregelungen
I. Einige Grundbegriffe
Die lebzeitige Übertragung von Vermögen -also nicht im Wege der gesetzlichen oder testamentarischen Erbfolge von Todes wegen- wird regelmäßig in der notariellen Urkunde als Überlassung bezeichnet. Sie findet im Regelfall unter nahen Angehörigen, z.B. im Verhältnis zwischen Ehegatten oder zwischen Eltern und Kindern statt.
II. Motive und Fallgruppen
Die Grundstücksübertragung findet regelmäßig im Wege der Vorwegnahme der Erbfolge statt. Weitere Motive der Grundstücksübertragung sind die ehebedingte Zuwendung oder der Schutz der Immobilie vor dem Zugriff der Gläubiger des Veräußerers, welcher beispielsweise eine wirtschaftlich risikobehaftete Tätigkeit als Unternehmer, Freiberufler, Existenzgründer etc. ausübt. Schließlich verfolgen Überlassungsverträge mitunter das Ziel, Pflichtteilsansprüche zu reduzieren oder mittels eines Versorgungsvertrages den Übergeber abzusichern.
III. Objekte der Überlassung
Eine einzelne Wohnung in einem Gebäude kann nur Gegenstand der Überlassung sein, wenn zuvor nach den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes eine Aufteilung erfolgte.
Anderenfalls kann nur das gesamte Anwesen oder Bruchteile hiervon übertragen werden.
Von einer mittelbaren Grundstücksschenkung spricht man, wenn der Schenker zweckgebunden Geld zum Erwerb einer bestimmten Immobilie oder zur Errichtung eines bestimmten Anwesens gibt. Diese Variante ist seit der Grundlegung des vollen Verkehrswertes nur noch begrenzt zu empfehlen, soweit bei einer zu Wohnzwecken vermieteten Immobilie eine Reduzierung um 10% (Verschonungsabschlag) gewährt wird.
IV. Gegenleistungen und Vorbehalte
Die Kosten der gewöhnlichen Unterhaltung (Grundsteuer, Versicherungen, Schönheitsreparaturen) fallen nach dem Gesetz dem Nießbraucher zur Last während der Eigentümer die außergewöhnlichen Aufwendungen oder außerordentliche Abnutzungen (Großreparaturen wie z.B. Dach oder Heizung) zu tragen hat. Allerdings können hiervon abweichend im notariellen Übertragungsvertrag alle Kosten zum Nießbraucher oder alle Kosten zum Eigentümer verlagert werden.
Beim Vorbehaltsnießbrauch kann der Veräußerer weiterhin die Gebäudeabschreibung geltend machen obwohl er nicht mehr Eigentümer ist.
2. Wohnungsrecht
Das Wohnungsrecht bleibt hinter dem Nießbrauch zurück, da es nur zur Selbstnutzung samt Gästen und Angehörigen, soweit nicht anders vereinbart, berechtigt. Anders als der Nießbrauch kann das Wohnungsrecht auf bestimmte Teile eines Gebäudes beschränkt werden (einzelne Räume, Wohnungen etc.). Diese müssen indessen im Vertrag genau bezeichnet werden. Typischerweise trägt der Wohnungsberechtigte seine Verbrauchskosten und die Schönheitsreparaturen in seinem Bereich. Die hausbezogenen Kosten (Grundsteuer, Versicherung) trägt der Eigentümer. Wenn nicht anders geregelt, ist eine Untervermietung oder Weitervermietung durch den Wohnungsberechtigten ausgeschlossen. Aufgenommen werden können indessen Ehegatten, Lebensgefährte und Gäste, es sei denn auch dies wäre vertraglich abgedungen. Das seiner Natur nach höchstpersönliche Wohnungsrecht ist nicht pfändbar und auch nicht auf den Sozialleistungsträger überleitbar. Es endet spätestens mit dem Tod, ferner bei endgültigem Auszug, wenn eine Rückkehr nicht mehr denkbar ist, nicht aber bei vorübergehendem Verlassen der Wohnräume.
3. Wiederkehrende Geldzahlungen
Wiederkehrende Geldzahlungen sind häufig in Überlassungsverträgen vorgesehen, die zugleich der Versorgung der Veräußerer dienen sollen. Der Vertrag muss in diesem Fall genau regeln, in welchem Rhythmus die Zahlungen fällig werden (monatlich, quartalsweise etc.), ob diese ihrer Höhe nach unabänderlich sind oder aber sich beispielsweise an die Inflationsrate anpassen (Indexierung) oder ob eine angemessene Anpassung verlangt werden kann, wenn z.B. der Bedarf der Veräußerer steigt oder aber die Leistungsfähigkeit des Erwerbers sinkt.
Stets sind bei wiederkehrenden Leistungen auch die steuerlichen Auswirkungen im Blick zu behalten: Unter bestimmten Voraussetzungen können solche Zahlungen vom Erwerber abgesetzt werden, müssen dann aber vom Veräußerer auch versteuert werden. Zu regeln ist schließlich auch, ob zur Sicherung der Zahlungsverpflichtung Eintragungen im Grundbuch (z.B. eine Grundschuld, die bei Einstellung der Zahlungen zur Verwertung der Immobilie berechtigt) erfolgen soll.
4. Naturalleistungen
Naturalleistungen werden insbesondere im Rahmen des sog. Altenteils in Form von Dienstleistungen vereinbart. Es handelt sich beispielsweise um Besorgungen, Fahrdienste, hauswirtschaftliche Verrichtungen etc. Auf staatliche Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz wirken sich solche vertraglichen Dienstleistungsansprüche nicht negativ aus. Anders verhält es sich möglicherweise bei Bezügen nachrangiger Sozialleistungen, etwa das steuerfinanzierte Bürgergeld sowie Leistungen der Grundsicherung und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Im Regelfall wird die Verpflichtung zur Erbringung von Pflege und Krankenleistungen im eigentlichen Sinne auf den Leistungsumfang bis zum Erreichen des Pflegegrades 2 beschränkt.
5. Mehrere Berechtigte
Bei einer Mehrheit von Berechtigten, wenn also beispielsweise Ehegatten das Anwesen gemeinsam übertragen und sich die vorstehenden Leistungen oder Nutzungen gemeinsam vorbehalten wollen, muss geklärt werden, in welchem Berechtigungsverhältnis beide zueinanderstehen. Klärungsbedürftig sind auch Fragestellungen der Art, wem das Wohnungsrecht im Fall der Scheidung der berechtigten Ehegatten zustehen soll. Klärungsbedürftig ist auch, ob bei Alleineigentum der Eigentümer Ehegatte sofort ein Nutzungsrecht erhalten oder ob ein solches erst aufschiebende bedingt im Zeitpunkt des Ablebens des übertragenden Alleineigentümer -Ehegatten- erfolgen soll.
V. Rückforderungsvorbehalt und Verfügungssperren
Gesetzliche Rückforderungstatbestände umfassen insbesondere den sog. groben Undank gem. § 530 BGB sowie die spätere sog. Verarmung des Schenkers gem. § 528 BGB.
Ein Widerruf wegen groben Undanks kommt nur innerhalb eines Jahres nach einer schweren Verfehlung, die der Beschenkte sich gegenüber dem Schenker hat zu Schulde kommen lassen und die zugleich auf eine subjektiv tadelnswerte Gesinnung schließen lässt, in Betracht. Derartige Fälle enden regelmäßig im Streit.
Eine Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers hat demgegenüber eine weitaus größere Bedeutung. Sie wird regelmäßig vom Sozialhilfeträger geltend gemacht, wenn der Veräußerer binnen 10 Jahre nach der Schenkung sich nicht mehr selbst unterhalten kann und nachrangige Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss. Der Anspruch der dem Veräußerer gegen die Erwerber zusteht, geht auf den Sozialleistungsträger bzw. die Stelle zur Gewährung des Bürgergeldes, über. Der Anspruch ist nicht auf Rückgabe des zugewendeten Anwesens in Natur gerichtet, sondern auf monatliche Zahlung der Unterhaltslücke durch den Beschenkten so lange bis der Nettowert der Zuwendung aufgezehrt ist. Der Beschenkte kann sich dabei nicht darauf berufen, dass er zur Erbringung der monatlichen Zahlung nicht genügend leistungsfähig sei. Der Rückforderungsanspruch bzw. die Wertausgleichszahlung, die in dessen Erfüllung geschuldet werden, gehen gesetzlichen Unterhaltstatbeständen vor. Dies bedeutet, dass also zunächst die Zuwendung rückabgewickelt wird und erst dann gegebenenfalls andere Geschwister aufgrund ihres Einkommens im Rahmen von Unterhaltszahlungen in Anspruch genommen werden.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der BGH dem Beschenkten ein Wahlrecht zwischen der monatlichen Zahlung der Unterhaltsrente einerseits und der Rückgabe des zugewendeten Gegenstands selbst gegen Erstattung der von ihm erbrachten Investitionen andererseits zubilligt.
2. Vertragliche Rückforderungstatbestände
Die Aufnahme vertraglicher Rückforderungstatbestände wird aufgrund der nur sehr begrenzten gesetzlichen Regelung häufig gewünscht. Häufig vereinbarte Sachverhalte, die den Veräußerer zumindest ein Recht zur Rückforderung der Immobilie geben, sind beispielsweise
a) die Veräußerung des Anwesens ohne schriftliche Zustimmung des Übergebers
b) die sonstige Weiterveräußerung, auch Schenkung der Immobilie ohne Zustimmung
des Übergebers
c) die Belastung der Immobilie ohne Zustimmung des Übergebers
d) die Pfändung der Immobilie von Dritter Seite
e) das Vorversterben des Erwerbers vor dem Veräußerer
f) die Ehescheidung des Erwerbers soweit nicht z.B. durch Ehevertrag sichergestellt ist,
dass das Schwiegerkind im Rahmen des Zugewinnausgleichs keine Ansprüche auf die
Wertsteigerung der Immobilie erhebt
g) denkbar sind weiter Rückforderungsvorbehalte, die etwa an das Entstehen von
Schenkungssteuer anknüpfen. Diese Regelung macht sich den Umstand zu Nutze,
dass bei Ausübung eines solchermaßen vorbehaltenen Rückforderungsrechtes
sowohl die Steuer für die aufgehobene Schenkung erstattet als auch für die Rück-
abwicklung keine neue Steuer erhoben wird, § 29 ErbStG.
3. Detailausgestaltung
Bei der Ausübung des Rückforderungsrechtes handelt es sich um ein höchstpersönliches Recht, das binnen einer gewissen Frist ausgeübt werden muss und nicht vererblich ist. Zu erwägen ist, das Rückforderungsrecht zumindest für einen Sterbefall vererblich zu stellen. Bei Durchführung der Rückabwicklung sind sodann nur die vom Erwerber tatsächlich getätigten werterhöhenden Investitionen mit ihrem noch vorhandenen Zeitwert rückzuvergüten, soweit sie mit Zustimmung des Übergebers vorgenommen wurden, nicht jedoch sog. Luxussanierungen. Der bedingte Anspruch auf Rückforderung sollte auf jeden Fall im Grundbuch durch eine Vormerkung (Rückauflassungsvormerkung) gesichert werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Rang der Vormerkung, insbesondere im Verhältnis zu Grundpfandrechten.
II.1. Die Grundstücksübertragung zur Vorwegnahme der Erbfolge
Im Sinn einer zeitlich gestaffelten Vermögensübertragung sollen die schenkungssteuerlichen Freibeträge (€ 400.000,00 je Elternteil und Kind), die alle 10 Jahre erneut zur Verfügung stehen, mehrfach ausgenutzt werden.
Häufig handelt es sich bei dem überlassenen Grundstück um das bisher und künftig selbst genutzte Eigenheim der Veräußerer, so dass die Beteiligten besonderes Augenmerk darauf legen, an den bisherigen Nutzungsverhältnissen und der bisherigen Lastentragung nichts zu ändern. Dies kann erreicht werden durch einen umfassenden Nießbrauchsvorbehalt. Allerdings muss den Veräußerern klar sein, dass zwar der Erwerber noch nicht eigenmächtig über das Anwesen verfügen kann, allerdings auch die Veräußerer selbst dazu nicht mehr in der Lage sind, so dass z.B. ein Verkauf oder eine Eintragung von Grundpfandrechten nur im Zusammenwirken von Veräußerer und Erwerber möglich sind.
Ferner sollte bei Übernahme des Objektes allein durch einen Abkömmling zugleich das Verhältnis zu den sog. weichenden Geschwistern geregelt werden.
II.2. Ehebedingte Zuwendung
Das Schenkungssteuerrecht privilegiert insoweit die Verwirklichung der ehelichen Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft, indem die Übertragung eines selbst genutzten Familienheims oder von Anteilen hieran gänzlich steuerfrei gestellt wird, also auf den (immerhin € 500.000,00 umfassenden) Freibetrag zwischen Ehegatten nicht angerechnet wird und zwar ohne weitere einschränkende Voraussetzungen. Geht das Familienheim im Falle der Vererbung auf den überlebenden Ehegatten über, muss dieser das Familienheim mindestens 10 Jahre selbst bewohnen und im Eigentum behalten, um die Steuerfreiheit zu erlangen.
In diesem Zusammenhang gilt es, das Augenmerk auch auf das Schicksal der Zuwendung für den Fall einer Trennung oder Scheidung zu richten. Soll die Überlassung weiterhin Bestand haben und allenfalls als Vorausleistung auf einen etwa geschuldeten Zugewinnausgleich gelten oder soll dem Zuwendenden ein Recht auf Rückforderung zukommen. Da es kein allgemeines gesetzliches Rückforderungsrecht bei Scheitern der Ehe gibt, ist hierzu eine vertragliche Lösung zu finden.
II.3. Veräußerer mit wirtschaftlich risikobehafteter Tätigkeit
Veräußerer mit wirtschaftlich risikobehafteter Tätigkeit sind häufig bestrebt, wichtige Vermögensteile vor einem etwaigen Gläubigerzugriff zu schützen. Derartige Übertragungen sind nur dann erfolgversprechend, wenn sie deutlich vor Eintritt der Krise stattfinden.
Bei Insolvenz oder erfolglosen Pfändungsversuchen eines Gläubigers besteht eine maximal 4-jährige Anfechtungsfrist. Ferner ist darauf zu achten, dass nicht der Veräußerer seinerseits pfändbare „Gegenleistungen“ vorbehält, wie etwa in Gestalt von Rentenzahlungen oder einem Nießbrauchsrecht; ungefährlich ist demgegenüber jedoch der Vorbehalt eines nicht übertragbaren Wohnungsrechts.
II.4. Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen
Durch rechtzeitiges Ausscheiden aus dem Nachlass sollen sich die Ansprüche pflichtteilsberechtigter Personen -Eltern, Ehegatten und Kinder- nur noch auf das „Restvermögen“ beziehen, das beim Ableben noch vorhanden ist. Allerdings beträgt die einzuhaltende Frist zwischen Übertragung und Eintritt des Erbfalles 10 Jahre, wobei diese lange Frist auch nicht zu laufen beginnt, solange sich der Übergeber wesentliche Nutzungen -etwa in Gestalt eines Nießbrauchs oder auch im Einzelfall eines Wohnrechtes- vorbehalten hat.
Erfolgte die Übertragung an den Ehegatten läuft die 10-Jahres Frist ebenfalls nicht an. Immerhin reduziert sich der Pflichtteilsergänzungsanspruch um 10% für jedes abgelaufene Zeitjahr -immer vorausgesetzt die Frist ist angelaufen (s.o.)-. Soll eine Schenkung auch zur Reduzierung des künftigen Pflichtteilsanspruchs des Beschenkten selbst gegenüber dem Schenker eingesetzt werden, muss diese Anrechnung spätestens bei der Zuwendung ausdrücklich angeordnet werden. Eine nachträglich konstruierte Anrechnung ist Testamentsform wurde im Zuge der Erbrechtsreform 2010 nicht umgesetzt.
II.5. Versorgungsvertrag
Im Vordergrund steht hier die finanzielle Versorgung des Übergebers, insbesondere durch regelmäßige Geldzahlungen, welche auf Lebenszeit oder aber bis zum Renteneintritt des Übergebers geschuldet werden, diese können der Höhe nach unabänderlich vereinbart werden (Leibrente) oder an persönlichen Faktoren wie der Leistungsfähigkeit des Beschenkten oder dem Bedarf des Schenkers ausgerichtet werden (dauernde Last). In diesem Zusammenhang gilt es auch die steuerlichen Erfordernisse für die Abzugsfähigkeit solcher wiederkehrender Leistungen beim Beschenkten im Blick zu behalten.